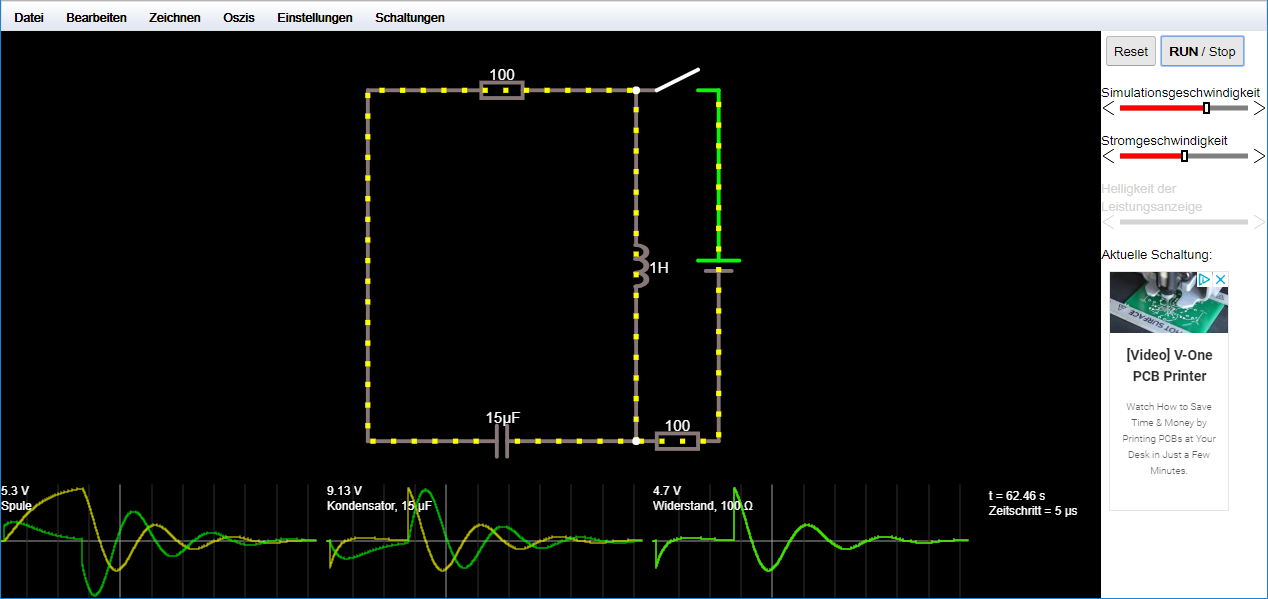16. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.
Grund zur Sorge?
Editorial
Low Code und No Code wollen Softwareentwicklung demokratisieren. Welche Auswirkungen hat dies für Softwareentwickler:innen?

Low-Code- und No-Code-Plattformen entstanden aus dem Wunsch, Geschäftsprozesse unabhängig von knappen Ressourcen schnell und flexibel in Software abbilden zu können. Angesichts immer kürzerer Innovationszyklen sollen sie Fachanwender:innen in die Lage versetzen, Anwendungen zu entwickeln, ohne selbst programmieren zu müssen.Tatsächlich ermöglichen Tools wie Mendix, Appian und Co. eine schnellere Erstellung von Prototypen, Apps und Workflows. Sie beschleunigen die Digitalisierung der Geschäftsprozesse in Unternehmen, entlasten professionelle Entwicklerteams bei Routineaufgaben, senken dank visueller Interfaces, Drag-and-Drop-Funktionalität und vorgefertigter Module Einstiegshürden für Laien und fördern die Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen einerseits und der Softwareentwicklung andererseits – Letzteres ist aus meiner Sicht ein nicht zu unterschätzender Vorteil in einer zunehmend interdisziplinären Arbeitswelt.